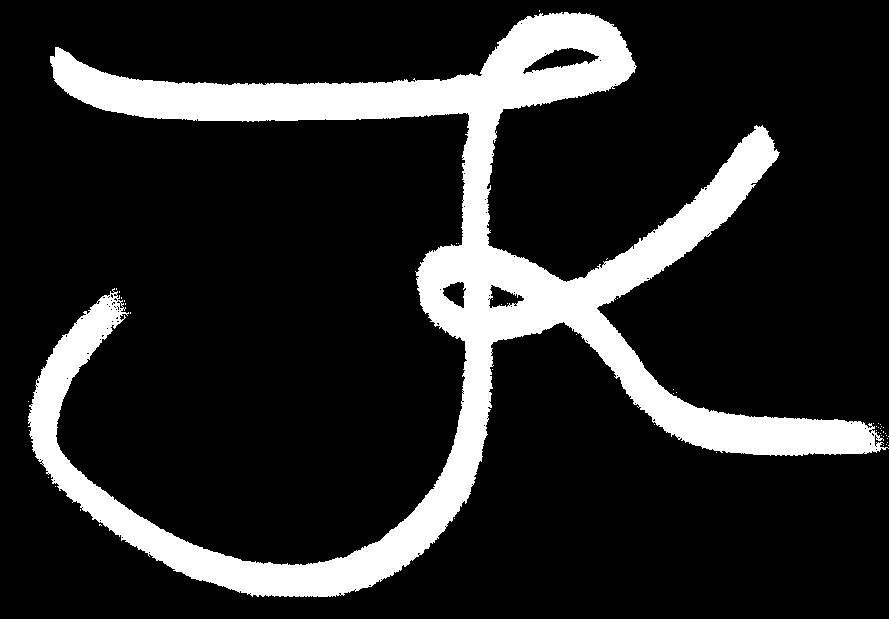Parsifal – Uwe Eric Laufenbergs mit Symbolbildern aufgeladene Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen
Auf der Schlachteplatte
von Wolfgang Behrens
Bayreuth, 25. Juli 2016
nachtkritik
Wer sich am diesjährigen Eröffnungstag der Festspiele dem Grünen Hügel nähert, der muss den Eindruck gewinnen, dass der Gralsbezirk der Wagnerianer massivster Bedrohung ausgesetzt ist. Eine Hundertschaft der Polizei ist im Einsatz, und während man Taschen öffnet und Sakkos lüftet, hat man Muße, ehrfürchtig die Gewehre der Einsatzkräfte zu studieren. Die Amokläufe und Terrortaten der vergangenen Tage tun ihr Übriges, um ein latentes Gefühl der Verunsicherung zu erzeugen: Die meisten Politiker sind vorsorglich erst gar nicht gekommen, der traditionelle Staatsempfang ist abgesagt. Natürlich sind das alles nur Sicherheitsvorkehrungen; von dem Bild aber, das sich bietet, geht eine seltsame Wirkung aus: Es ist, als rüste sich die freie Welt zu einem Rückzugsgefecht um einen der letzten vorgeschobenen Posten der Hochkultur.
Perspektivloses Leiden
Später findet man dieses Bild der Bedrohung ins Opernhaus hinein verlängert: Uwe Eric Laufenberg, der Regisseur der diesjährigen „Parsifal“-Premiere, hat aus Richard Wagners Bühnenweihfestspiel eine Fantasie über das Christentum in Zeiten der Bedrängnis gemacht. Laufenbergs „Parsifal“ verortet sich zwar nicht im Hier, aber doch sehr klar im Jetzt: Sein Bühnenbildner Gisbert Jäkel hat ihm das Innere einer kleinen, bereits etwas baufälligen Kreuzkuppelkirche auf die Bühne gesetzt, die irgendwo im Wüstengebiet der nordarabischen Welt liegt, in Syrien oder im Irak.
![]()
Lagerstätten unter Kirchenkuppeln: Bühnenszenerie im Bayreuther „Parsifal“ © Enrico Nawrath
Wenn sich noch während des Vorspiels der Vorhang über dieser Szenerie hebt, lagern dort Flüchtlinge. Nur kurze Zeit später marschieren Soldaten hindurch und sichern die Lieferung einer neuen hölzernen Christusfigur ab. Die Kirche ist hier längst Multifunktionsraum geworden: Der Orden, der hier waltet, duldet neben sich eine Zivilbevölkerung, die ihrerseits auf Asyl angewiesen ist.
Abendmahl und andere Rituale
Eine Leitidee in Laufenbergs „Parsifal“ ist, dass sich das Christentum unter der äußeren Bedrängnis über seine Rituale trotzig auf sich selbst besinnt. Während der Alltag gewissermaßen im Schlendergang absolviert wird – und es wird viel geschlendert in dieser Inszenierung! –, bilden die Rituale ein Kraftzentrum. Allerdings zu einem hohen Preis: Gralskönig Amfortas, dem Ryan McKinny mächtige und expressive vokale Statur verleiht, leidet unendlich unter der Abendmahlszeremonie, denn er selbst wird hier zum Spender der Blut-Droge (wie Einar Schleef den Wein der Eucharistiefeier so gerne nannte). Laufenberg lässt Amfortas mit Christus in eins fallen: Dornenbekrönt schleppt er sich dahin, bis die Gralsritter schließlich seine Wunde öffnen, um sich ihre Blut-Droge direkt abzuzapfen. Der Abendmahlstisch wird zur Schlachteplatte.
![]() Parsifal im Bade mit Blumenmädchen © Enrico Nawrath
Parsifal im Bade mit Blumenmädchen © Enrico Nawrath
Dass eine auf derartiges Leiden gegründete Religion keine dauerhafte Perspektive bietet, springt einem aus diesem starken Bild förmlich entgegen. Und momentweise verfolgt Laufenbergs Inszenierung diesen Strang auch weiter: Der heilige Speer, der die Wunde schlug, wird hier gerade nicht zum Gegenstand der Verehrung, sondern im zweiten Aufzug von Parsifal – hier seinem Geistesverwandten Siegfried aus dem „Ring“ folgend – zerbrochen. Im dritten Aufzug schließlich werden die Trümmer des Speers wie auch viele andere heilige Symbole aus verschiedensten Religionen – mit denen der Chor vorher noch wild drohend Amfortas zu einer letzten Blutspende zwingen wollte – zusammen mit dem verstorbenen Gralskönig Titurel beerdigt. Erst in der Überwindung, in der Aufhebung der religiösen Symbole und Riten, so scheint es Laufenberg mit Wagner sagen zu wollen, kommt die Religion des Menschlichen zu sich. Es bleibt das utopische Bild befreiter Menschen, die aus der Kirche hinaus ins Weite (und Friedliche?) gehen.
Mit Kinderglauben
Es ist leicht, diesem Ansatz eine gewisse Naivität vorzuwerfen. „Trennt euch von der Religion, dann kommt der Frieden schon von allein!“ So einfach ist’s vielleicht doch nicht, aber in solch naivem Kinderglauben steckt auch eine große Kraft. Leider ist es aber noch viel leichter, Laufenberg jenseits dieses religionskritischen Strangs eine mitunter fahrlässig klischeelastige Regie anzukreiden.
![]() Kundry (Elena Pankratova) mit sterbendem Kind im Arm © Enrico Nawrath
Kundry (Elena Pankratova) mit sterbendem Kind im Arm © Enrico Nawrath
Das beginnt bei routiniert lahmer Chorführung, geht über banale Filmchen, in denen nach Vorbild von Zehn Hoch ein simpler Kosmos-Zoom die Zeit zum Raum werden lässt, wird peinlich in Orient-Stereotypen, bei denen Parsifal im Hamam von Burka-Trägerinnen verführt werden soll, die sich zuletzt als pittoreske Bauchtänzerinnen entpuppen. Und endet bei einem Karfreitagszauber, der eine Paradieskitschpostkarte mit Tropenpflanzen, im Regen tanzenden nackten Jungfrauen und generationenübergreifender Familienfotoaufstellung präsentiert. Man hofft, dass das wenigstens ironisch gemeint sei – aber was soll es ironisieren? Printprodukte der Zeugen Jehovas?
Höhepunkt trifft Tiefpunkt
Besonders ärgerlich ist dieser Kitsch-Ausrutscher, weil gerade an dieser Stelle das Dirigat des kurzfristigen Einspringers Hartmut Haenchen (für den fahnen- bzw. Thielemann-flüchtigen Andris Nelsons) in seinem Bestreben, die Partitur noch im scheinbar Statischen im beständigen Fluss der Phrasen zu halten, ganz zu sich selbst kommt – ein musikalischer Höhepunkt trifft so auf den szenischen Tiefpunkt.
Dem musikalischen Part bleiben freilich die eklatanten Niveauschwankungen der Regie ohnehin erspart: Georg Zeppenfeld als Rahmenerzähler Gurnemanz passt mit seinem ungemein kantablen, jede Phrase in ihrer melodischen Fülle nachgestaltenden Ansatz ohnehin perfekt in Haenchens Konzept. Klaus Florian Vogts fabelhaft hell timbrierter Tenor ist für den Toren Parsifal fast eine Idealbesetzung, eine Passage wie „Mit diesem Zeichen bann ich deinen Zauber“ wird man reiner kaum je hören können – nur bei manchen Ausbrüchen („Wehe! Wehe!“) wünschte man sich manchmal mehr Aufbäumen in der Stimme. Elena Pankratova als Kundry verband ihre hochdramatische, mit einer beeindruckend satten Tiefe gesegnete Darstellung mit großer, in dieser Rolle nicht eben häufig anzutreffender Tonhöhengenauigkeit. Allein den durchaus sonoren Klingsor Gerd Grochowskis hätte man sich noch ein wenig schwärzer vorstellen können.
Jenseits evolutionärer Wucherung
Ursprünglich hatte die Festspielleitung – wir wollen das nicht vergessen! – für diesen „Parsifal“ den Erz- und Totalkünstler Jonathan Meese als Regisseur vorgesehen, den man vor anderthalb Jahren aber kurzerhand wieder auslud. Bei Meese hätte es „evolutionär wuchern“ sollen, „auf Videoprojektionen, mit Malerei auf Kostümen, auf Flächen.“ Man hätte das „Urwüchsige, Unkontrollierte“ erlebt. Vielleicht wäre der uneingehegt wuchernde Meese ja die wirklich massive Bedrohung für den Grünen Hügel gewesen. Dieser hat man sich nun erfolgreich entzogen. Zum Preis von einigen guten Ideen – und viel schlechtem Stadttheater.
Die Kritik zur Eröffnungspremiere
Bildquelle: Enrico Nawrath
Premierenkritik
Der neue „Parsifal“ in Bayreuth
Bei der großen Verwandlungsmusik im ersten Akt wird ein Video eingespielt. Wie bei Google Earth entfernt sich die Kamera aus der Vogelperspektive vom Ort des Geschehens. Man sieht das Kirchendach von oben, die Wüste drumrum, von Ruß geschwärzt, das Zweistromland, den Nahen Osten, die Erdkugel, das Sonnensystem, die Galaxis mit vorbeisausenden Planeten. Anschließend zoomen wir uns wieder heran – vom Weltall immer näher bis zum Altar, auf dem Amfortas die Enthüllung des Grals vorbereitet. Wie der leidende Christus steht er da, mit Dornenkrone, Lendenschurz und Wundmalen. Einer der Mönche sticht in die Wunde in seiner Seite, das Blut wird aufgefangen und als gruseliges Abendmahl an die Mönche ausgeschenkt. Das Christentum, so schlicht ist das wohl zu verstehen, macht Menschen leiden.
Platte Symbolik
Der Islam, so zeigt der zweite Akt, ist auch nicht besser. Die Blumenmädchen in Klingsors Zaubergarten bevölkern ein türkisches Dampfbad, erst vollverschleiert, dann im freizügigen Bikini-Dress. Für solche Bauchtanz-Erotik aus dem Bilderbuch der europäischen Orientklischees haben die realen Islamisten zwar rein gar nichts übrig, aber stimmig ist ohnehin wenig in dieser Inszenierung. Das Thema Kampf der Religionen wird nur angetippt. Dafür wird umso mehr herumgestanden.
Ringelreihen zwischen Blumen
Die Lösung aus dem ganzen Schlamassel zeigt der dritte Akt: zurück zur Natur. Dicke Aloe-Vera-Blätter wachsen durchs Klostergemäuer. Beim Karfreitagszauber fällt sogar Regen in der Wüste, dazu tanzen junge nackte Frauen zwischen Riesenblumen fröhlich Ringelreihen. Eigentlich könnte doch alles so schön sein! Wir könnten Frieden haben. Wir könnten Freude haben. Wir müssten dazu nur alle religiösen Symbole, christliche, jüdische und islamische, in Titurels Sarg entsorgen. Schon würden sich die Menschen vertragen. Leider ist weder die Wirklichkeit noch Wagners „Parsifal“ so einfach gestrickt. Regisseur Uwe Eric Laufenberg will ein großes Rad drehen. Er inszeniert das Stück als Gleichnis auf das Gewaltpotential der Religionen, als Plädoyer für die Befreiung aus den Fesseln des Dogmas. Das ist gut gemeint, handwerklich schwach umgesetzt, oft langweilig und leider auch nicht frei von Kitsch.
Musikalisch überzeugend
Umso mehr überzeugt die musikalische Seite. Der helle Tenor von Klaus Florian Vogt hat an Körperlichkeit und Wärme gewonnen. Mühelos und kraftvoll klingt dieser wunderbar strahlkräftige Parsifal – eine tolle Leistung! Eine sehr große, warme Stimme hat Elena Pankratova in der Rolle der Kundry. Ihre eindrucksvollen Spitzentöne schleudert sie mit gezielter Wucht in den Zuschauerraum, findet aber auch im piano zu differenzierter Gestaltung. Nicht ganz auf dieser Höhe bewegt sich Ryan McKinny als zuverlässiger, aber etwas gaumig klingender Amfortas. Grandios dagegen Georg Zeppenfeld als Gurnemanz. Als geborener Erzähler meistert er die langen Monologe mit fesselnder Präsenz. Jedes Wort ist verständlich, die Stimme mit sattem Bassfundament ist stets fokussiert und klar.
Dirigent Hartmut Haenchen, der für den wundersam verschwundenen Andris Nelsons einsprang, meinte vor der Premiere bescheiden, er wolle wenigstens versuchen, diesem „Parsifal“ in den wenigen verbleibenden Proben seine Handschrift zu geben. Das ist ihm höchst überzeugend gelungen. Pulsierende Tempi halten den breiten Strom der Musik wie durch natürliches Gefälle immer im Fluss. Stehende Gewässer und düster wabernde Klangnebel gibt es hier nicht. Die musikalischen Bögen gliedern sich, die Melodien sprechen: Dieser Wagner atmet. Hartmut Haenchen hat sich größten Respekt verdient. Und der neue Bayreuther „Parsifal“ ist wirklich rundum – hörenswert.
Festspiel-Auftakt in Bayreuth
Kann Laufenbergs „Parsifal“ punkten?
Jürgen Liebing und Jörn Florian Fuchs im Gespräch mit Sigrid Brinkmann
Deutschlandfunk Kultur
25.07.2016

Schafft die Neuinszenierung des „Parsifal“ es, die Kritiker zu überzeugen?
Auftakt der Bayreuther Festspiele mit der Premiere des „Parsifal“: Nur wenige Wochen zuvor war der Dirigent ausgetauscht worden, auch der Regisseur sollte ursprünglich ein anderer sein. Konnte die Inszenierung trotzdem überzeugen?
Aus der SendungFazit
Die Bayreuther Festspiele sind bekannt für ihre Skandale. Die Inszenierung des „Parsifal“ war gleich von zwei Personaldebatten begleitet. Zum einen wurde Regisseur Jonathan Meese schon vor längerer Zeit gefeuert. Zum anderen trat vor vier Wochen überraschend Dirigent Andris Nelsons zurück. Das Publikum sieht daher eine Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg mit Harmut Haenchen als Orchesterleiter.
Vor der Inszenierung gab es das Gerücht, Laufenbergs „Parsifal“ könne islamkritisch sein. Festivalleiterin Katharina Wagner wies die Spekulationen zurück und forderte alle auf, sich das Stück erst einmal anzusehen.
Neuenfels: Katharina Wagner kann das Niveau nicht halten
Regisseur Hans Neuenfels hatte zuvor auf Deutschlandradio Kultur die Festspiele kritisiert. Neuenfels sprach im Zusammenhang mit der Festspielleitung von „Unfähigkeit“, „Präpotenz“ und „Privatismen“. Das sei schade für einen „so kostbaren Ort wie Bayreuth“.
Besonders griff Neuenfels Katharina Wagner an: Sie schaffe es scheinbar nicht, Bayreuth auf dem Niveau zu halten, das man erwarten müsse. Es gebe inzwischen viele Wagner-Aufführungen an anderen Orten, die besser seien als die in Bayreuth.
Bayreuther Festspiele überschattet von Attentaten und Amoklauf
Die Bayreuther Festspiele dauern bis zum 28. August. Wagners letzte Oper „Parsifal“ ist die einzige Neuinszenierung dieses Jahr. Der Komponist hatte sie speziell für das Festspielhaus geschrieben und wollte sie nur dort aufgeführt sehen.
Überschattet wurde der Auftakt von den Bluttaten der vergangenen Tage. Auf dem Bühnenvorhang vor Beginn der Parsifal-Aufführung stand die Aufschrift: „Die Bayreuther Festspiele widmen die heutige Aufführung allen Opfern der Gewalttaten der vergangenen Tage und ihren Angehörigen.“ Zahlreiche Polizisten patrouillierten am Festspielhaus, Taschen von Besuchern und Zaungästen wurden kontrolliert, der rote Teppich für die Prominenz gestrichen. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hatte den traditionellen Staatsempfang nach der Aufführung abgesagt.
Für einen Produktion, die sich einem frühen Regiewechsels und dem Rücktritt ihres Dirigenten kaum zwei Wochen vor der Premiere stellen musste, macht Bayreuths neuer Parsifal vieles richtig. Uwe-Eric Laufenberg, Intendant in Wiesbaden, wurde der Giftbecher gereicht, die Ablöse für Stefan Herheims epochale Produktion des Werkes (2008-2012) zu inszenieren, als es mit ersten Wahl der Festspiele nicht klappte. Seine Lösung erweist sich anhand jüngster Bayreuth-Standards als eher zahm – keine Ratten, keine ausfließenden Fermenter, Farbschlachten oder Krokodile, die andere Werke im jüngsten und aktuellen Festivalrepertoire charakterisiert haben. Die Tatsche, dass Laufenberg die Oper nicht im mythischen Mittelalter ansiedelt, mag für machen zu modern sein, doch die Bayreuth-Stammgäste von heute sind aus härterem Zeug gemacht und daran gewöhnt, vielleicht ein bisschen mehr herausgefordert zu werden als in dieser Inszenierung. Und doch tut sie das, was sie zu tun sucht, ausgesprochen gut.
Die Handlung wird in den heutigen Irak versetzt, wo eine christliche Gemeinschaft aller Widrigkeiten zum Trotz ausharrt. Ihre Kirche wurde zerbombt, doch Mönche und Gemeinde machen tapfer weiter. In der Zwischenzeit gibt der abtrünnige Klingsor, insgeheim noch Christ, wie sein geheimer Schrein von Kruzifixen vermuten lässt, nach außen hin den Eindruck, zum Islam konvertiert zu haben, und seine Blumenmädchen entledigen sich schwarzer, islamischer Kleidung und werden zu exotischen Verführerinnen. Im dritten Akt angekommen ist die Kirche kaum mehr als eine Ruine und die Mitglieder aller drei abrahamitischen Religionen haben gegenseitigen Schutz gesucht.
Doch mit Parsifals abschließender Heilung von Amfortas‘ Wunde werden all ihre religiösen Artefakte und Symbole in Titurels offenem Sarg verstaut, als alle zusammen in eine postreligiöse Zukunft gehen. Das ist genau, was Wagner mit Blick auf Feuerbach und Schopenhauer im Sinn hatte, dass Erlösung dadurch kommen würde, dass man den Verlass auf die Religion überwindet. Diese Art, das Fazit des Werkes zu inszenieren, ist in letzter Zeit zur gängigen Lösung für Parsifal-Produktionen geworden und es gab weitere Reminiszenzen von früheren Inszenierungen, beispielsweise das brutale Öffnen von Amfortas‘ Wunde und das Teilen seines Blutes im Ritual im ersten Akt, ebenso Amfortas‘ nicht vom Libretto motivierter Auftritt, um im zweiten Akt seine Liaison mit Kundry wieder zu erleben.
„Zum Raum wird hier die Zeit“ (engl. Here time becomes space), wie Gurnemanz Parsifal die Heimstatt des Grals beschreibt, und während der Verwandlungsmusik im ersten Akt zoomt ein projiziertes Video aus der Mitte des Kirchendaches heraus zu den Enden des Kosmos und zurück (hier können wir im Satellitenbild auch den geographischen Ort als Mosul festmachen). Zugegeben, das englische Wortspiel mit „space“ [dt. Raum, aber auch All, Anm. d. Übersetzerin] mag im Deutschen nicht funktionieren und kann darum als zufällig angesehen werden, doch es erwies sich als atemberaubendes Zwischenspiel. Die vergleichbare Szene im dritten Akt begleiten Todesvisionen von Kundry und Titurel sowie – aus keinem ersichtlichen Grund – Wagners Totenmaske. Ein weiteres, unerklärtes Element ist eine regungslos dasitzende Figur auf dem Kirchendach in den ersten beiden Aufzügen, die man am Ende des dritten zusammengesunken und tot sieht. Vielleicht war es am Ende doch Wagner.
Bedenkt man, dass er das Dirigat so spät von Andris Nelsons übernommen hat, zeigte Hartmut Haenchen, dass er die schwierige Akustik des Theaters schon bei der zweiten Vorstellung gemeistert hatte. Er wählte modisch rasche Tempi in diesem berüchtigt langsam laufenden Werk, doch nie schienen diese übereilt, und er gab seinen Sängern viel Raum. Klaus Florian Vogts verlieh der Titelrolle keinen konventionell heroischen Wagnertenor und sein fahler Ton hatte eine Tendenz zum Monotonen, doch er sah als Unschuldiger, der Selbstoffenbarung erfährt, gut aus.
Abgesehen davon war die Besetzung so gut, wie man es in diesem Werk heutzutage zu hören bekommt. Georg Zeppenfelds Gurnemanz war ein Meisterkurs in klarer Artikulation, opulentem Basston und vokalem Charisma, und Elena Pankratovas Kundry war packend, nirgends mehr als auf ihrem forschen und ausgedehnten „lachte“, das das Publikum in der darauffolgenden Stille sprachlos ließ. Ryan McKinny, durchnässt und blutend, zeigt seine Kunst als wohlwollender, stimmlich runder Amfortas. Karl-Heinz Lehner gab einen energischen Titurel und Gerd Grochowski war als Klingsor bei starker Stimme. Die Gralsritter, Knappen und Blumenmädchen bewährten sich und der kraftvolle Bayreuther Festspielchor wurde seinem Ruf als bester Opernchor im Geschäft gerecht.
Aus dem Englischen übertragen von Hedy Mühleck.
Bamberger Erzbischof nennt Bayreuther Parsifal „anstößig“
von Peter Jungblut
Bayrischer Rundfunk
29.07.2016, 15:10 Uhr

Am Ende des Bayreuther „Parsifal“, der am 25. Juli Premiere hatte, werfen Juden, Muslime und Christen die Symbole ihres jeweiligen Glaubens in einen Sarg und gehen in ein „buddhistisches“ Nirwana. Das stört Bambergs Erzbischof Ludwig Schick.
Überraschend deutlich äußerte sich der Kirchenmann zur eigentlich sehr konventionellen Bayreuther „Parsifal“-Inszenierung. Wörtlich sagte Schick in einem dpa-Interview:
„Wagner ist ein Suchender, er suchte über die herkömmlichen Religionen hinaus, ohne sie im Sarg zu beerdigen. Das herauszustellen, wäre sachgemäß gewesen.“
Nach Auffassung des Erzbischofs ist die Wagner-Inszenierung «für einen Christen schon anstößig», weil die Glaubenssymbole im Schlussbild entsorgt werden. Seine Kritik habe er in einem doppelten Sinn gemeint. Regisseur Uwe-Eric Laufenberg mache sich Gedanken über das Christsein und darüber, was es heißt, authentisch zu leben. Er stelle „die Religionskritik stärker heraus, als es Wagner selbst“ getan habe. Im Übrigen werde diese starke Kritik dem Christentum auch nicht gerecht wird, so Schick.
Die religionskritische, aber sonst sehr konservative Inszenierung des „Parsifal“ war von Opernkritikern heftig verrissen worden. Es war von „unfreiwilliger Komik“ die Rede (Süddeutsche Zeitung) und einer „Illustration statt Inszenierung“ (Die Welt). Andere nannten die Produktion „flach und belanglos“ und wunderten sich, was dem Regisseur „alles nicht eingefallen sei“. Sogar von „Fremdschämen“ war die Rede (FAZ). Das Bayreuther Publikum allerdings reagierte gnädig: Es gab nur drei Buhrufer und sehr freundlichen Applaus.
Parsifal at Bayreuth, review: ‚a triumph‘
Mystical: Parsifal
By Mark Ronan
The Telegraph
27 JULY 2016 • 9:21AM
Can Christians, Jews and Muslims live in harmony in the Middle East?
The final scene of Bayreuth’s new Parsifal supplies a message of hope when these three
faiths come together in the opera’s final act of redemption. The opening performance of the 2016 Festival had been forced to become a low-key affair with a heavy security clampdown in view of the current atrocities in Germany committed by Middle Eastern immigrants.
In a sign of solidarity with the victims of the recent Munich shootings by a German-Iranian teenager, the State of Bavaria cancelled the high-end reception at the Schloss Tiergarten for the first time ever. Food went to waste, and the usual red carpet at the Festspielhaus where a vast press corps normally awaits Germany’s political luminaries was entirely absent. The chill winds of modern mayhem blew against what is arguably Wagner’s most religiously sensitive opera, disturbing a warm Bavarian night, but leaving unspoilt the musical and artistic value of a new production that the audience applauded for a full 10 minutes at the end. Wagner’s final and most abstract opera, Parsifal is set in the mystical Land of the Grail, which once sent its Knights out to perform good works, before the disintegration of their king Amfortas. Seduced by Kundry in Klingsor’s magic realm, he can no longer perform his office, but into this decaying brotherhood, beautifully described by the wise old knight Gurnemanz, steps Parsifal, unknown and unrecognised, to save them all. In Uwe Eric Laufenberg’s production, he and dramaturge Richard Lorber have taken the brotherhood as a community of Christian monks in the Middle East ready for renewal and rebirth. As Laufenberg says, “Where
Christianity is under threat… these are precisely the places where (and this is
something the last three popes have repeatedly emphasised)… it is capable of being regenerated”.
A particular inspiration is the seventh-century monastery of Mar Musa in Syria,
where in Act I we see the monks caring for refugees, though the video images in
Gurnemanz and Parsifal’s extraordinary Act I journey to the Land of the Grail suggest a location in Iraqi Kurdistan. The location seems to be in deliberately nebulous Middle East terrain rather than Isil-occupied Iraq, as some are reporting. For Klingsor’s realm in Act II, where the magician presides over a collection of crucifixes, the imagery is Islamic, and when Parsifal enters as a US serviceman the flower maidens in their black abayas strip to gorgeous Ottoman-era seductiveness, turning later to an Eden-like beauty and simplicity. Finally in Act III the temple of the Grail evokes the interior of a synagogue with a small painted cross on one wall, where Jews
and Muslims join the monks to watch Parsifal bring unity and redemption to an
almost ruined world.
This bold vision, under gripping musical direction by Hartmut Haenchen, with
Georg Zeppenfeld as a slim Gurnemanz in Muslim head-covering providing
unparalleled vocal command and depth of sympathy, carried all before it. With Klaus
Florian Vogt as a powerfully heroic Parsifal, along with the beautiful gold, silver and piercing iron of Elena Pankratova’s voice as Kundry, Gerd Grochowski as a subtle and
well sung Klingsor, American baritone Ryan McKinny as a noble and agonised
Amfortas, and his father Titurel (Karl-Heinz Lehneras) seen here as an old man rather than a cavernous voice inside a coffin, this was a cast of distinction, helping Bayreuth to recover its reputation for musical and artistic supremacy.
The chorus was exceptional as always, and despite reported artistic differences
between Andris Nelsons and music director Christian Thielemann that led to
Haenchen replacing Nelsons, the new conductor rallied the orchestra using his own score, creating a musical triumph.